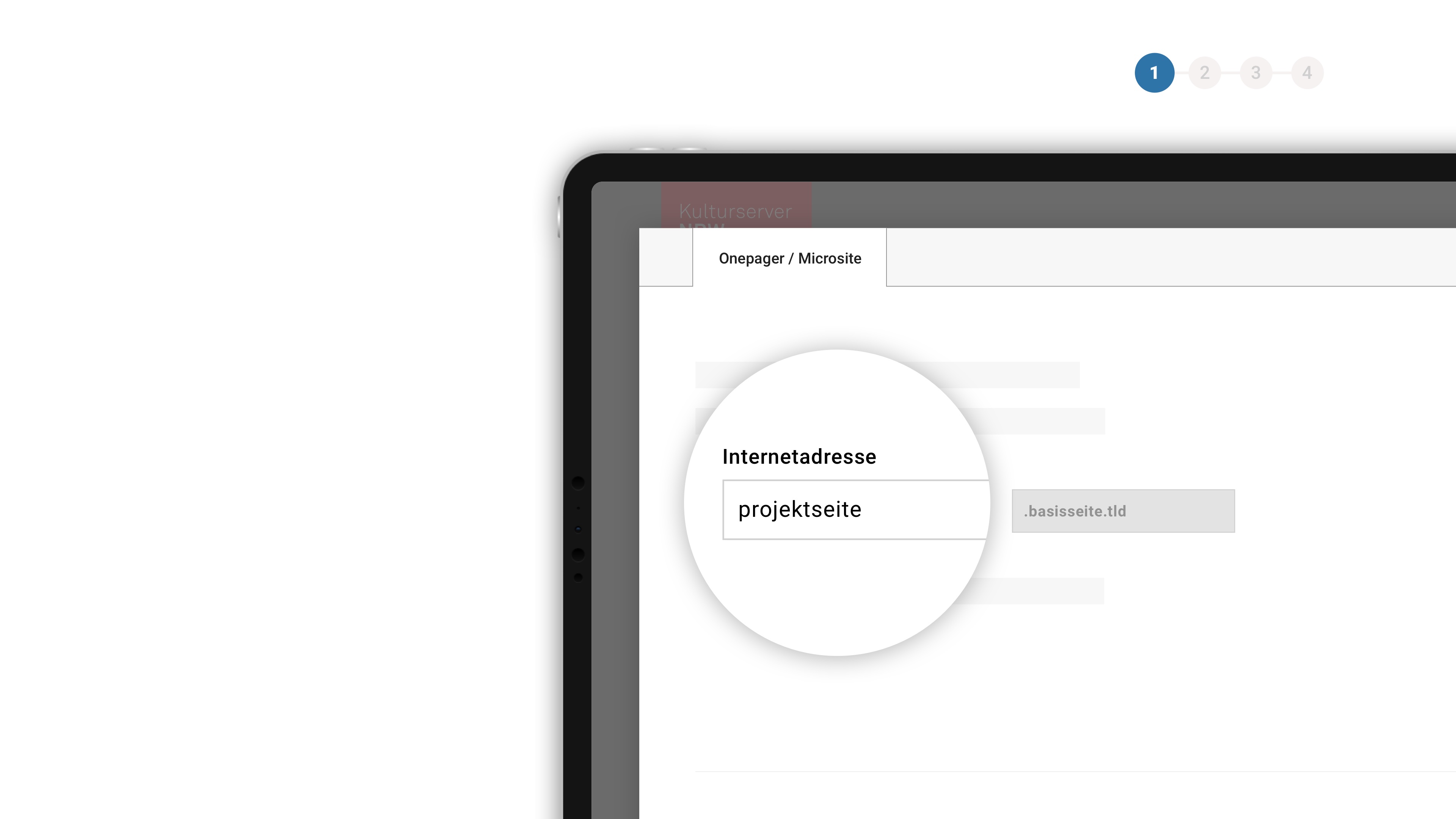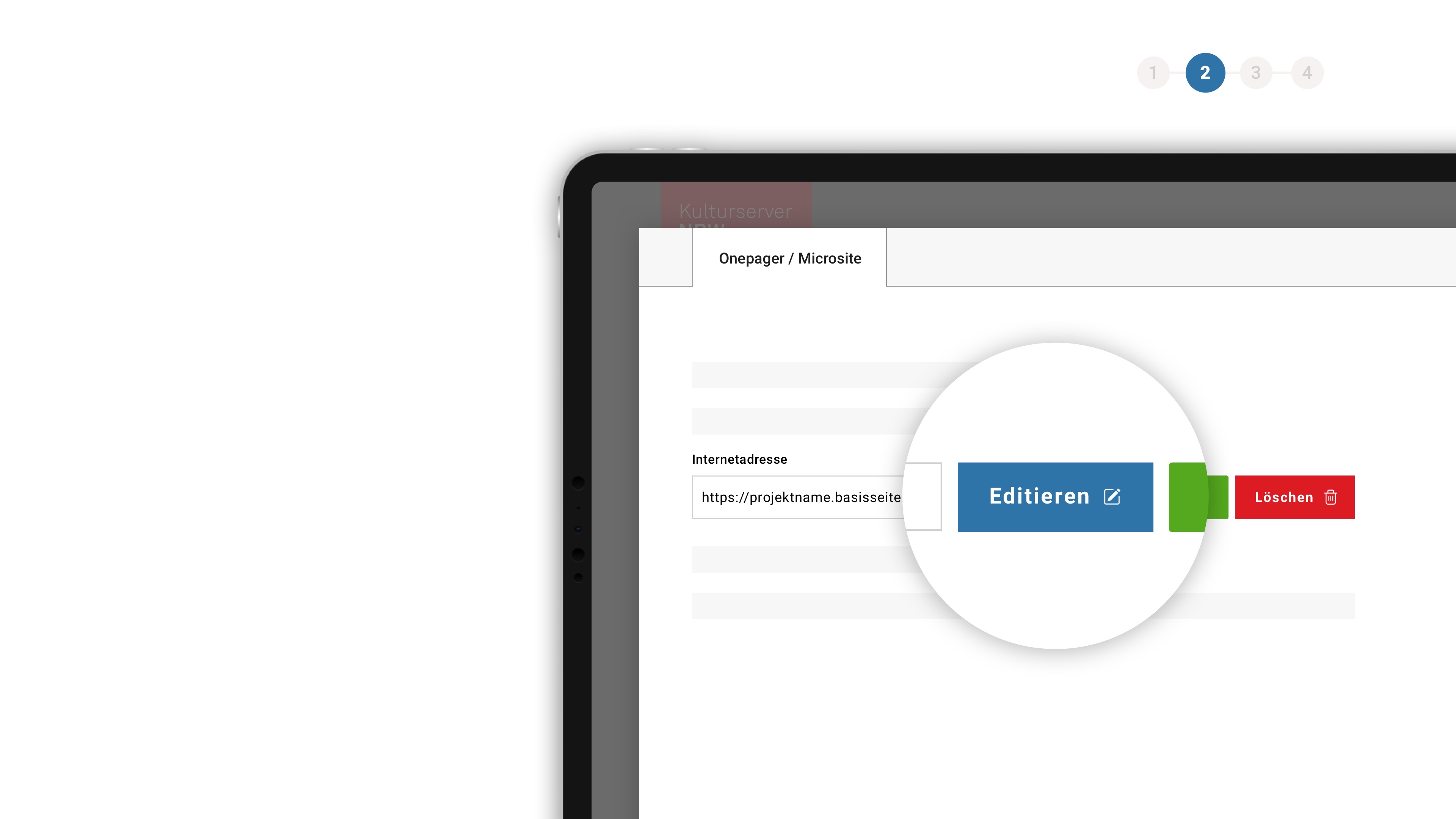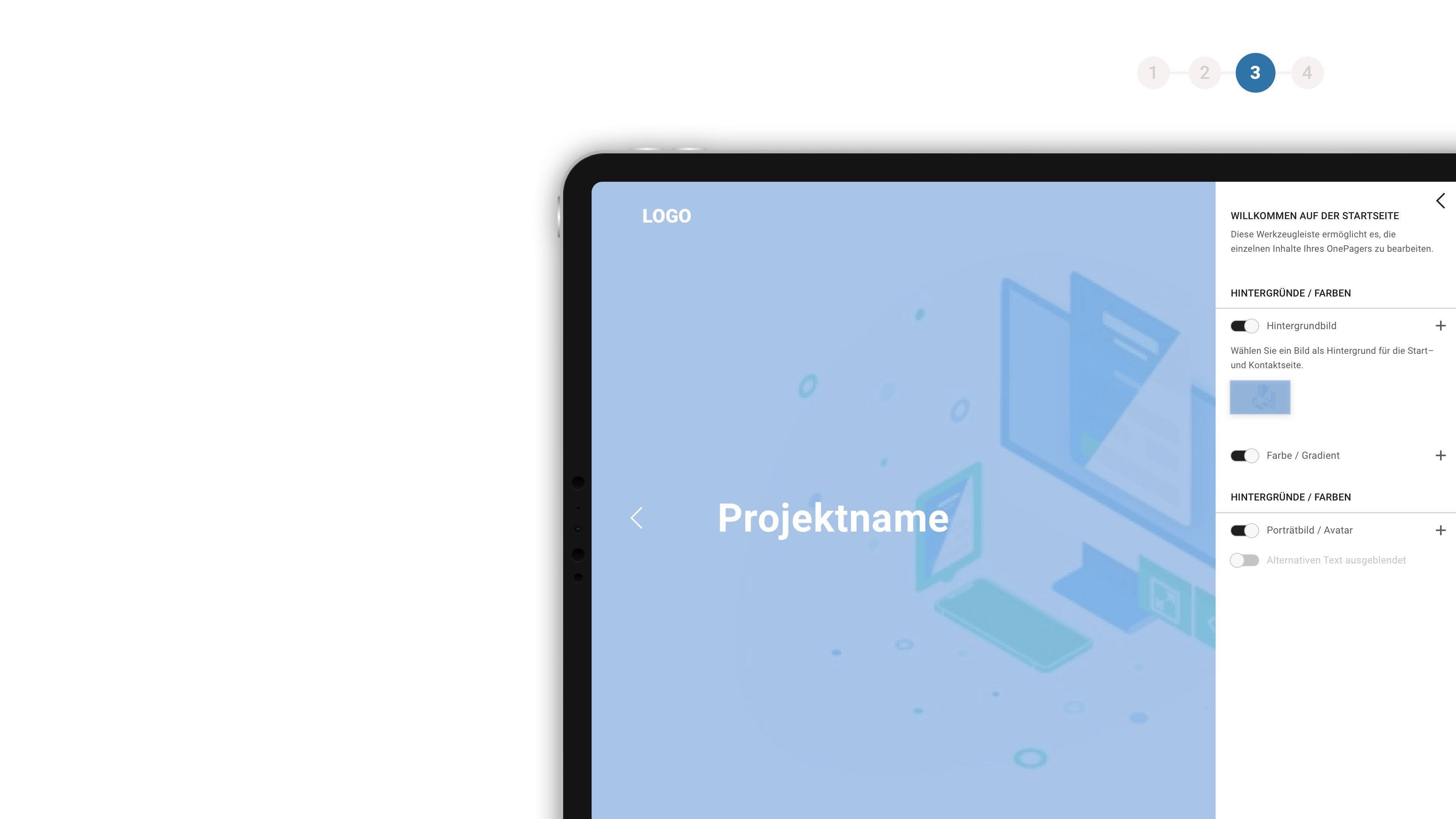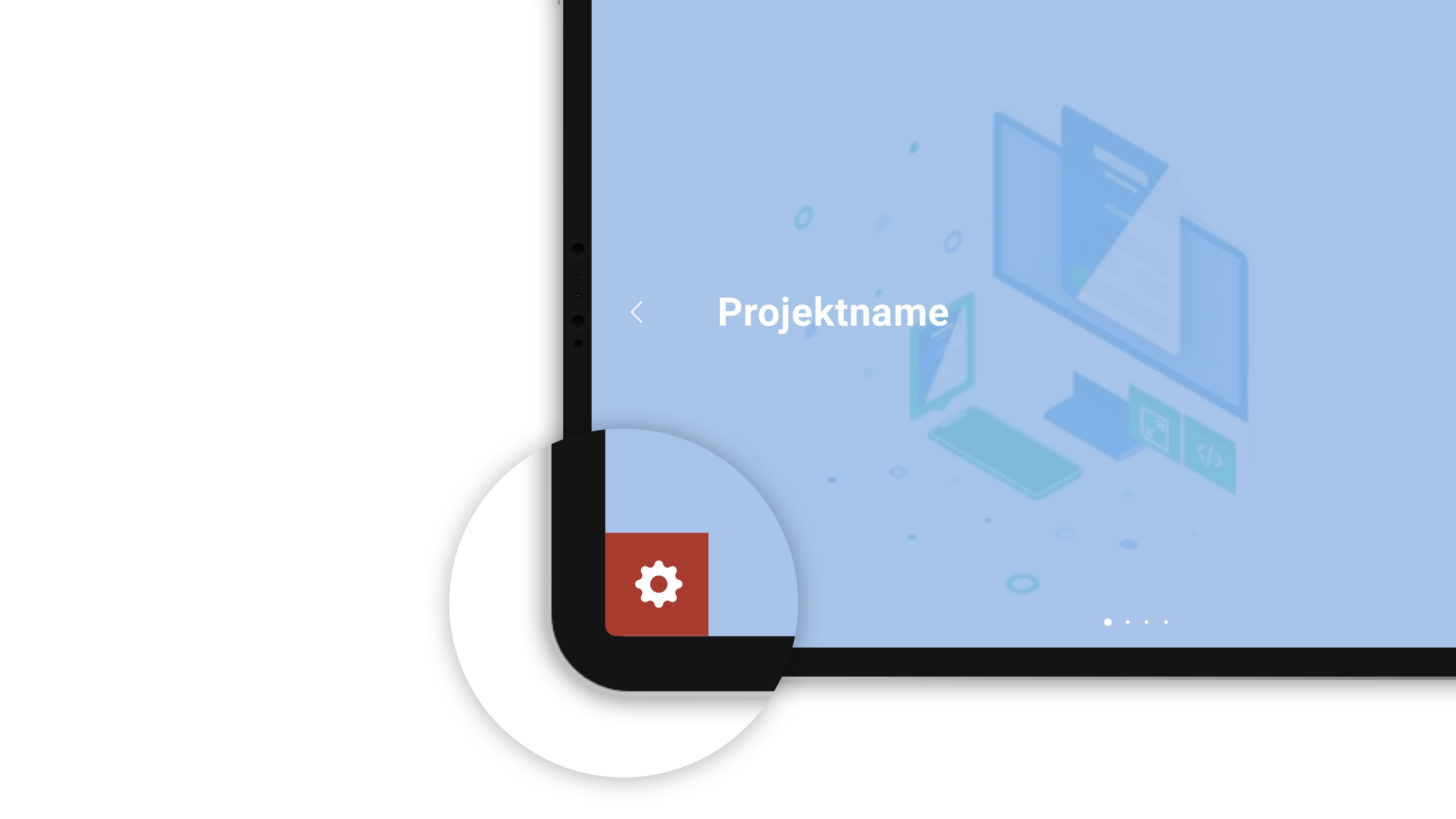Stadtentwicklung
Stadtentwicklung in Köln - Interview mit Isabel Strehle
Von einem Dom zum nächsten: Zwischen Juni 2017 und Ende 2019 arbeitete die Architektin und Städtebauerin Isabel Strehle im Dezernat für Stadtentwicklung, Planen und Bauen der Stadt Köln – zunächst als persönliche Referentin des Beigeordneten, danach als Fachreferentin für Stadtentwicklung bei Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Anfang 2020 wechselte die Münchnerin in eine kleinere Stadt, die sich mit Köln die lange Geschichte und den Hang zu gotischen Sakralbauten teilt: In Aachen ist Isabel Strehle Fachbereichsleiterin für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilitätsinfrastruktur. Manch eine*r in Köln vermisst ihren regen, innovativen Geist. Grund genug, mit ihr zu sprechen: Was ist gute Stadtentwicklung? Wie können Bürger*innen oder Kunst dabei mit einbezogen werden? Und was könnte Köln von Aachen lernen?
Frau Strehle, was macht gute Stadtentwicklung für Sie aus?
Ich bin überzeugt davon, dass wir die ganzen Brains, Ideen und Energien unserer Stadtgesellschaften viel stärker zum eigentlichen Teil der Stadtentwicklung machen können. Das ist eine grundsätzliche Haltungsfrage. Für eine Stadtverwaltung ist das natürlich eine große Herausforderung. Zu einem solchen Transformationsprozess gehört auch, dass die Akteur*innen diverser werden und sich Aufgaben neu aufteilen. Wir brauchen u.a. Gesetzesänderungen und Menschen mit anderen Qualifikationen. Außerdem ist die Stadtgesellschaft plural, und nur weil eine Gruppe oder gar eine Mehrheit etwas möchte, heißt das nicht, dass das alle anderen auch wollen. Es ist auch legitim, dagegen zu sein. Die grundsätzliche Herausforderung ist: Wie kann man das moderieren? Wie schafft man ein gemeinsames Erfolgserlebnis? Das müssen wir alle erproben – von der Verwaltung über die Architekt*innen bis zu den Bürger*innen.
Sie waren in ihrer Kölner Zeit auch in die Entwicklung des Ebertplatzes eingebunden. Wie haben Sie das zwischen Sommer 2017 und Ende 2019 erlebt?
In dieser doch recht kurzen Zeit wurde der Ebertplatz intern als Schlüsselprojekt kommuniziert. Man sah in der Zwischennutzung eine Chance zur Transformation der Stadt. Der Platz sollte gepflegt und erprobt, sollte von seinem Stigma befreit werden. All das kann Zwischennutzung. Das muss ich in der transformativen Stadtentwicklung niemandem erklären – einem Stadt- oder Polizeidirektor aber schon. Zwar hatte Henriette Reker kein konkretes Nutzungskonzept – aber um keinen Preis wollte sie, dass der Ebertplatz zugemauert wird. Es ging also zunächst darum, innerhalb der Verwaltung eine Ermöglichungskultur zu etablieren. Die erste politische Vorlage aus dem November 2017 beinhaltete zunächst nur, kaputte Lampen auszuwechseln, am Grünschnitt zu arbeiten und Drogenverstecke zu beseitigen. Es war kaum Zeit, etwas Inhaltliches zu erarbeiten, das Kooperation und Beteiligung ermöglicht. Aus diesem Bedürfnis heraus entstand der Beschluss der Verwaltung zu den ersten drei Jahren Zwischennutzung, dem die Kölner Politik im Wesentlichen gefolgt ist. Ganz wichtig waren dabei die Künstler*innen-Initiativen, die anfangs Briefe geschrieben und konkrete Vorschläge eingebracht haben. Die Zwischennutzung ist aber kein Selbstläufer. Sie kann auch verpuffen. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen einer Groß- und einer Millionenstadt wie Köln. Die Stadt Köln hat da leider viel auf die lange Bank geschoben und sich bis heute verheddert. Klar hat der Ebertplatz viele Aufgaben, für die KVB ganz andere als für die Kunst. Da sind wir wieder bei den Entscheidungsprozessen und wie man diese moderiert.
Gibt es in Aachen denn ein vergleichbares Beispiel?
Ja, ein viel kleineres zwar, aber der Theaterplatz ist eines der sogenannten Aachener Knotenprojekte. Mitten in der Innenstadt steht ein klassizistischer Theaterbau von Friedrich Schinkel aus dem 19. Jahrhundert. Er sollte einst das touristische Profil der Großstadt Aachen kulturell aufwerten. Irgendwann war der Theaterplatz kein Platz mehr, sondern umspült von mehreren Verkehrsspuren. Immer wieder hat man darüber diskutiert, was sich daran ändern ließe – doch aus verschiedenen Gründen hat das nie geklappt. Anfang 2020 haben wir dort ein Reallabor initiiert. Zunächst wurde der Verkehr umgelenkt. Es durften nur noch Busse mit 10 km/h am Theater vorbeifahren. Dadurch gewannen wir Fläche, auf der vieles stattfinden kann: Aufenthalt, Außengastronomie, Kultur. Kurz nach Projektbeginn kam der erste Lockdown und viele Veranstaltungen mussten ausfallen. Die Blumentröge und Low-Tech-Möbel standen aber schon. Und so haben sich die Menschen den Ort angeeignet. Im Sommer 2020 war dann viel los – von Theater und Performances bis zur europäischen Mobilitätswoche. Ein Jahr später beschlossen die Gremien, den Durchgangsverkehr für immer vom Theaterplatz zu entfernen. Das Reallabor war die wesentliche Grundlage für die Auslobung eines städtebaulichen Wettbewerbs. Anfang 2024 werden wir beginnen, den Platz umzubauen.
Verglichen mit dem Ebertplatz ist das ja ziemlich schnell!
Ja klar, es ist ein Prio-Projekt. Da gehört sehr viel Kommunikation in alle Richtungen dazu. Wir lassen die Politik kontinuierlich an unseren Überlegungen teilhaben. Die Interessen von Stadttheater oder Einzelhandel, von ÖPNV oder Radfahrer*innen sind nicht deckungsgleich. Da muss immer wieder moderiert werden. Insgesamt ist es ein riesiges Infrastrukturprojekt, das viel können soll und dementsprechend groß ist die Erwartungshaltung. Aber das macht auch viel Freude.
Warum gehen solche Dinge in Aachen so viel schneller als in Köln? Sind es die schlankeren Strukturen?
Es hat definitiv etwas mit der Größe der Städte und ihren Verwaltungen zu tun. Köln steckt mitten in einer überfälligen Verwaltungsreform, die auf viele Jahre angelegt ist. Die Stadt ist geprägt von ihrer Korruptionsgeschichte, die – als letztes großes Desaster – im Einsturz des Stadtarchivs mündete. Es musste durchgegriffen werden. Daraus folgte, dass aus einem 4-Augen-Prinzip quasi ein 20-Augen-Prinzip wurde. Schon bei kleinen Vergaben ab 2.500 Euro musste der Baudezernent persönlich unterzeichnen. Das ist zwar gut gemeint, doch nimmt es Projektleiter*innen die Verantwortung, wenn sie 19 weitere Menschen neben oder über sich haben, die mit um die Entscheidung ringen. In Aachen sind meine Mitarbeiter*innen selbstständiger. Das ist eine Kulturfrage, die kann man heilen, auch in Köln. Aber das braucht Zeit.
Außerdem hatte Köln Anfang der 2000er haushaltslose Jahre und war nicht handlungsfähig. Dadurch wurde im Personalbereich gespart. Wurde eine Stelle neu besetzt, hat man sie in der Entgeltgruppe abgewertet. Das hat die Verwaltung leider kaputt gespart: Die gleiche Aufgabe für schlechteres Geld bei schlechterer Ausbildung? Da sind Fehler vorprogrammiert. Auch das zu korrigieren, braucht Jahre. Und auch das ist in Aachen anders, da wir diese Vorgeschichte nicht haben. Aachen hat gerade eine super Ausgangslage. Wir wachsen stark in den Bereichen Mobilität und Straßenbau. Aber für immer wird das so auch nicht bleiben. Ich kenne Stadtentwicklung nur in Wellenbewegungen. Das sieht man den Städten auch über die Jahrhunderte an: Sie haben Hochphasen, dann ganz normal-solide Phasen – mal kürzer, mal länger –, und manchmal auch einen Einschlag, den niemand vorhersehen oder von außen beeinflussen kann.
In welcher Phase befindet sich dann Köln? Sind die Menschen am Ebertplatz oder in den Hallen Kalk einfach nur zur falschen Wellenphase aktiv? Sind sie ihrer Zeit voraus?
Nein, das glaube ich nicht. Auch Köln macht sich auf den Weg. Ich würde einer Stadt nicht ihre Ausgangslage vorwerfen – die ist einfach, wie sie ist. Sie ist in Köln nur ganz anders als in Aachen. Köln kann man sofort benutzen, und das ist großartig und einladend. Sie hat ihr Welterbe, das gepflegt wird, aber nur 100 Meter weiter kann man sie direkt in Gebrauch nehmen. Aachen mag schön sein, Köln ist robust.
Der Kölner Ebertplatz ist ein Beispiel für mehr Einbezug der Bürger*innen in der Stadtplanung. Wie funktioniert Bürger*innen-Beteiligung in Aachen?
Der Bürger*innen-Dialog beginnt bei uns grundsätzlich mit Transparenz. Alle wichtigen Informationen sollen allen zur Verfügung stehen. Das ist auch in Aachen noch nicht eingeübt, sondern wurde erst in den letzten drei Jahren bei der Beschäftigung mit dem Thema Mobilität wichtiger. Heute klären wir den Grad des Dialogs und der Beteiligung mit den Bürger*innen sehr früh im Prozess. Nicht immer ist der gleich hoch. In diesem Kontext haben wir einige neue Begriffe etabliert: Wir unterscheiden zwischen Stadtmacher*innen und Ideengeber*innen. Ideengeber*innen können Ideen für die Entwicklung eines Standorts oder eines Quartiers in den Diskurs einbringen und Wünsche äußern. Stadtmacher*innen gehen darüber hinaus. Sie machen sich auch Gedanken zur Umsetzung und Finanzierung. Nicht alle müssen Stadtmacher*innen sein, aber ganz häufig suchen wir solche aktiv unter den Bürger*innen. Ein Beispiel dafür ist das Altstadtquartier Büchel, das sich zwischen Weltkulturerbe und Rotlichtviertel am Rande der strukturschwachen Innenstadt befindet. Hier sind im Dialog mit den Stadtmacher*innen sehr vielseitige Nutzungsideen entstanden – von 50 bis zu 5.000 Quadratmetern. In einem Workshop haben wir die Akteur*innen zusammen gebracht und ihre Ideen geschärft. Hier hat die Stadt Aachen tatsächlich in einem Prozess mit der Stadtgesellschaft ihre Entwicklung vorangetrieben.
Das ist ein sehr erfreulicher und ja längst nicht selbstverständlicher Prozess. In vielen Fällen handeln Stadtverwaltungen hinter verschlossener Tür Deals mit Investoren aus. Wie viel Sagen haben Investoren(-gruppen) denn in Aachen? Sie sagten in einem anderen Zusammenhang ja auch, in Aachen werde es keine Neuversiegelung von Boden geben.
Da komme ich gleich wieder zum Altstadtquartier Büchel: Das hat sich die Stadt, so weit möglich, von Investoren zurückgekauft und dabei eine Stadtentwicklungsgesellschaft gegründet. In Aachen ist die Stadt Trägerin der Planungshoheit, d.h. wir schaffen das Planungsrecht. Das ist ein großartiges Recht, mit dem sich viel gestalten lässt. Wir haben dabei einen solidarischen Ansatz, also: Die Stadt ist immer schon da. Wenn jemand neu dazu kommt und dort etwas entwickelt, profitiert er von dem, was bereits da ist. Und deshalb hat er auch den Auftrag, etwas zurückzugeben. Jede Quartiersentwicklung beginnt mit einer Bestandsanalyse, in der die bestehenden Bedarfe des Quartiers ermittelt werden. Daraufhin kann die investierende Partei etwas entwickeln, über das die Politik dann entscheidet. Im Anschluss folgt auf dieser Beschlussgrundlage ein Qualifizierungsverfahren – mal eine Mehrfachbeauftragung, mal ganz klassischer Wettbewerb, manchmal aber auch eine Werkstatt. Bürger*innenbeteiligung ist dabei nicht ausgeschlossen. Und was die Versiegelung betrifft: Es gibt in Aachen einen Bauland-Beschluss, den wir auch durchsetzen. Darin ist genau festgelegt, wie hoch Versiegelungsanteile bei neuen Projekten sein dürfen. Vor allem wird tatsächlich entsiegelt. In ehemals gewerblichen Arealen nehmen wir oft den Asphalt weg. Das ist auch fürs Klima und den ökologischen Haushalt Aachens gut.
Einmal noch zurück zum Kölner Ebertplatz. Der Vergleich zum Aachener Theaterplatz ist interessant: An beiden Orten spielt die Kunst eine Rolle in der Neugestaltung, jedoch ist es in Köln die freie Szene, in Aachen hingegen eine städtische Kulturinstitution. Welche Rolle spielt die freie Kulturszene für die Entwicklung der Stadt Aachen?
Für mich persönlich eine große. Die freie Szene war beim Reallabor sehr aktiv, u.a. war sie mit Tanzperformances und Konzerten beteiligt. Auch bei dem beliebten Sommerfest „Stadtglühen“ war sie, gemeinsam mit den städtischen Kulturbetrieben, stark mit einbezogen. Grundsätzlich sind die Leute aus der Kultur – auch aus der freien Szene – genauso Teil des Ganzen wie diejenigen aus der Bildung oder der sozialen Arbeit. Sie müssen aber Ressourcen haben, um mitwirken zu können. Zu einer demokratischen Stadtentwicklung gehört auch ein künstlerischer Ansatz. Ich fände es toll, wenn die Kunst eine kommentierende Rolle dabei einnimmt.
Was heißt denn kommentierend? Sie soll nicht aktiv handeln, sondern aus der Distanz heraus agieren?
Planung kann sehr intuitiv sein und Planung kann sehr analytisch sein. Ich würde der Kunst immer die Freiheit lassen, sich weder dem einen noch dem anderen anschließen zu müssen. Sie soll einfach machen. Ja, auch Irritation darf sein. Das ist doch total erfrischend in so einem lange anhaltenden Planungsprozess, wenn es da einen Akteur gibt, der eine gewisse Freiheit hat. Planung will ja gerne antizipieren, aber das will ich der Kunst nicht aufoktroyieren. Sie soll sich selbst souverän äußern.
Das Interview führte Friedemann Dupelius
Mit freundlicher Unterstützung durch: KULTUR.GEMEINSCHAFTEN - Kulturstiftung der Länder / Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien / NEUSTART KULTUR
In Kooperation mit diskursmusik.com