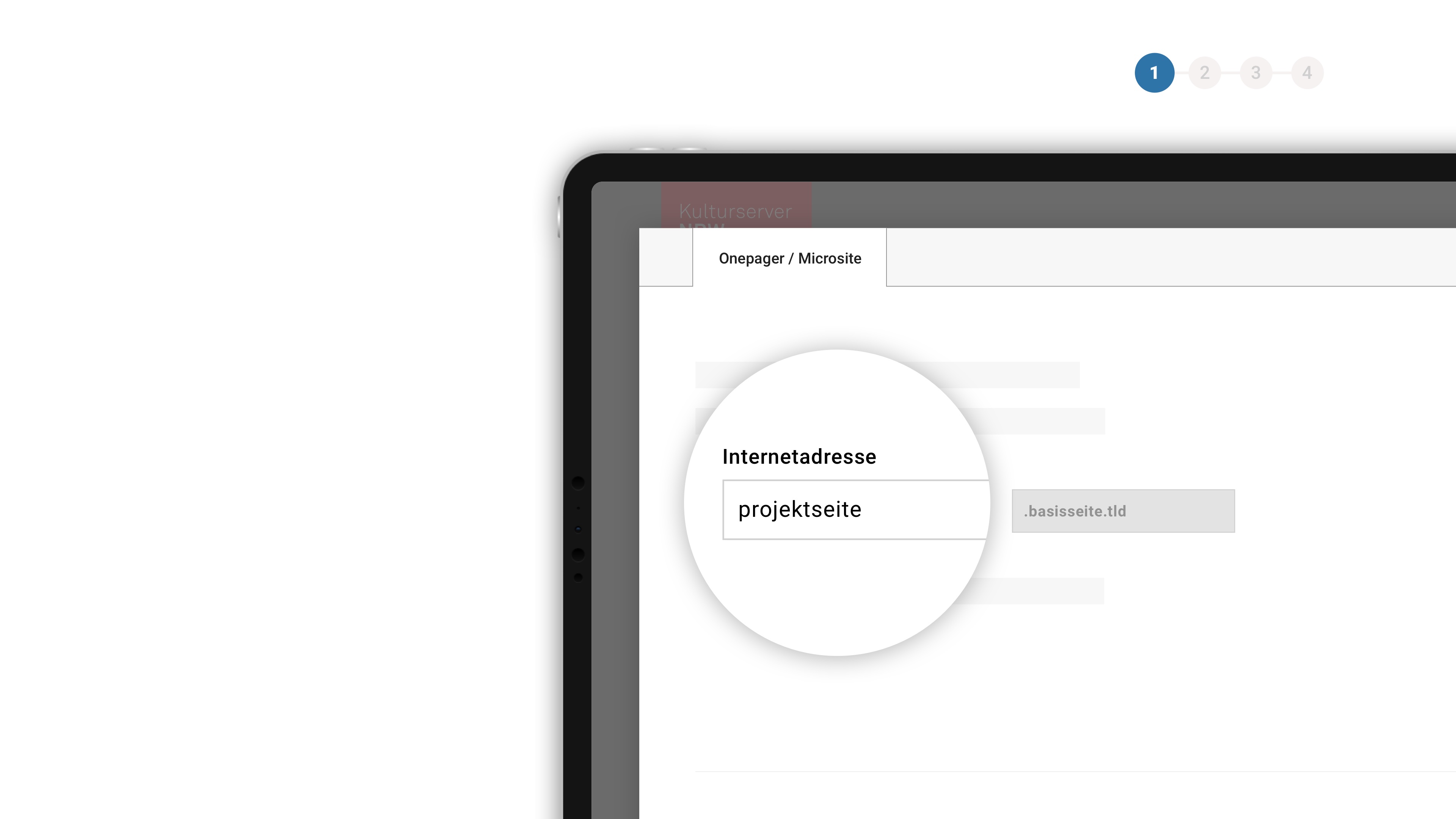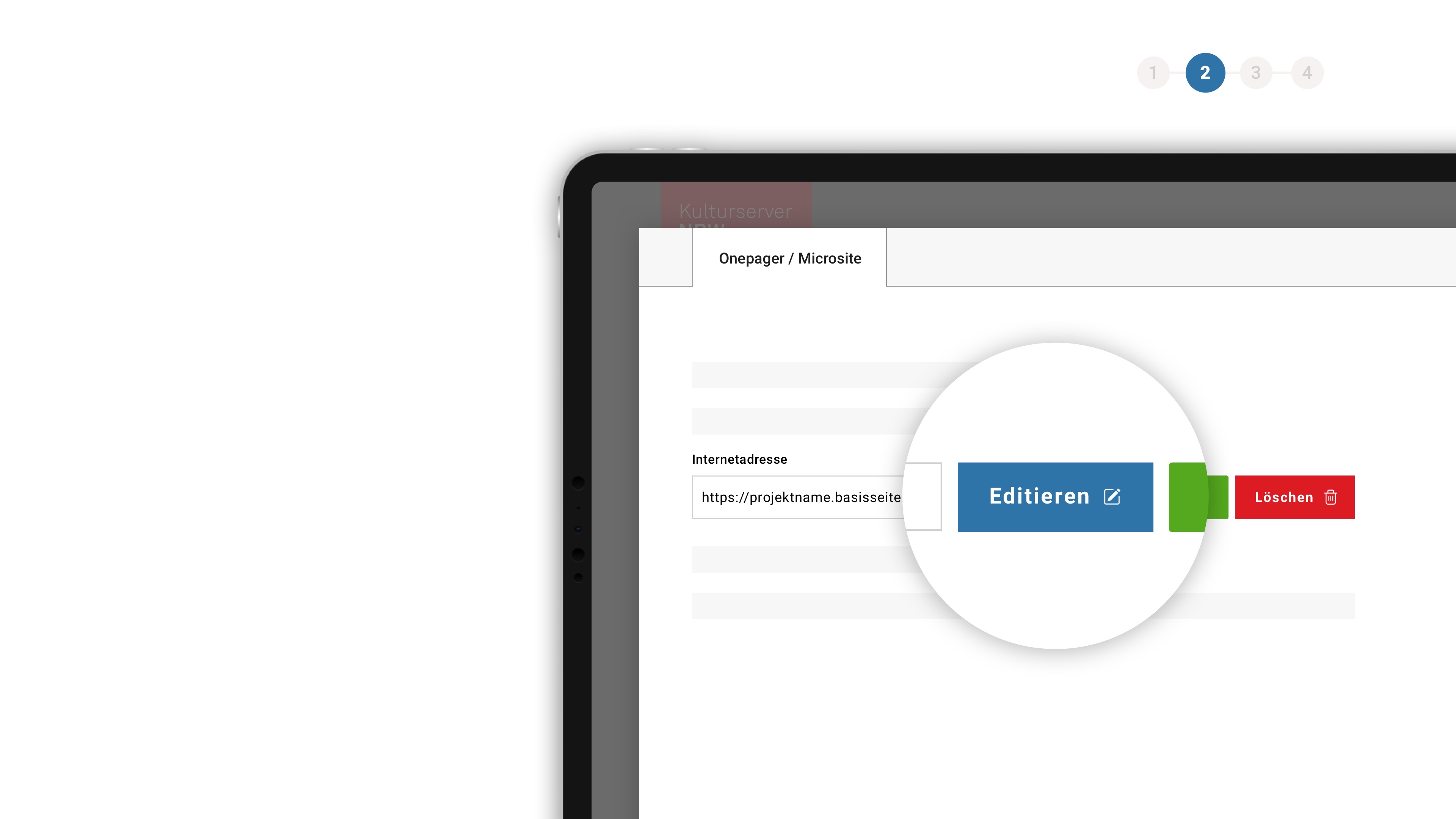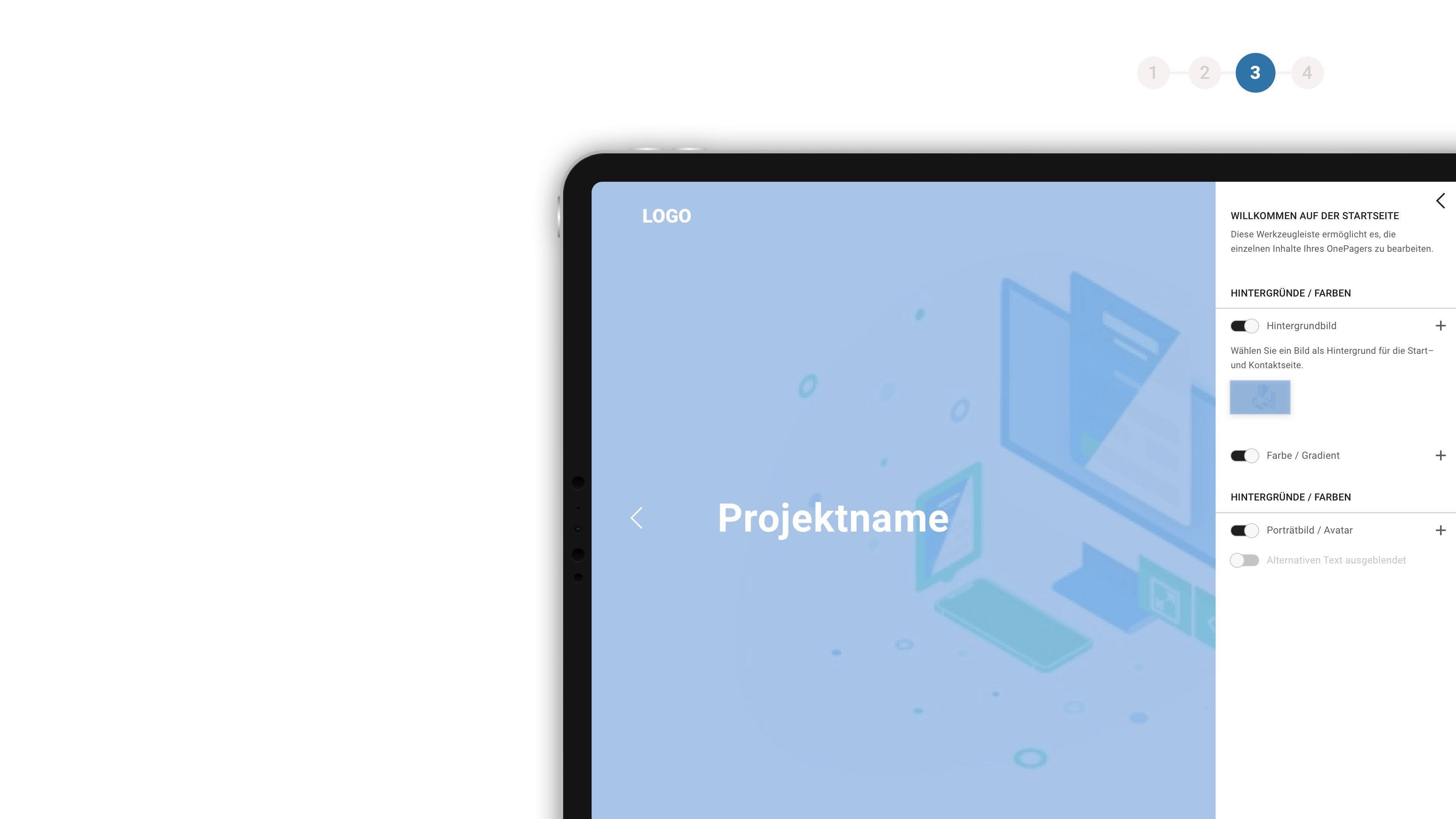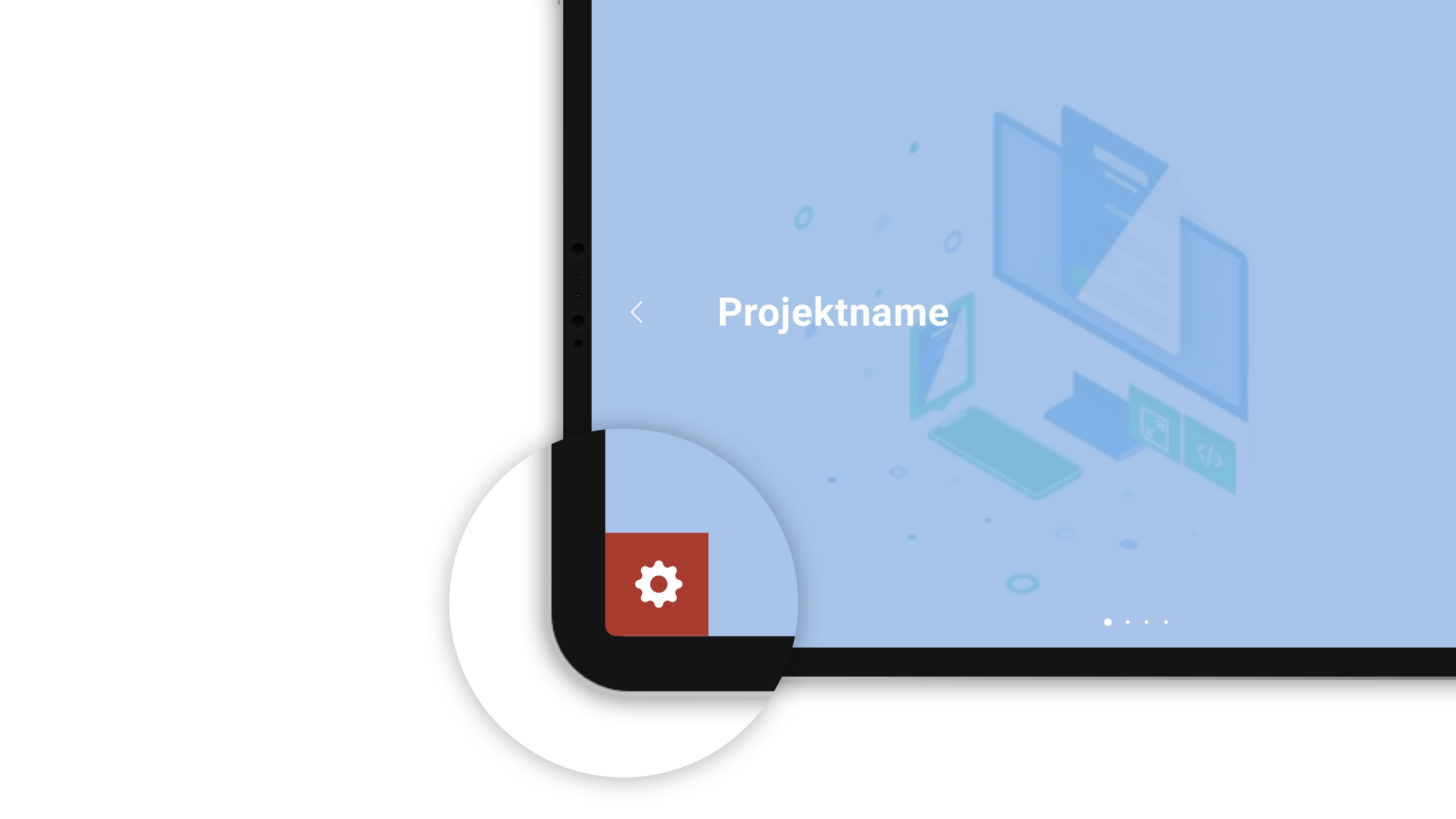Safe Space Köln?
Ein Gespräch über Gender und Köln als Ort zum Arbeiten und Studieren mit den Musiker*innen und Künstler*innen Ursula Wienken, Will Saunders und iSaAc Espinoza Hidrobo. Die Fragen stellte Martina Jacobi.
Was hat euch nach Köln gebracht?
Ursula Wienken: Ich komme aus NRW und studiere seit dreieinhalb Jahren E-Bass im Fachbereich Jazz/Pop an der Hochschule für Musik und Tanz (HfMT), deswegen bin ich nach Köln gekommen. Ich bin Bassistin, spiele Kontrabass und E-Bass, und mache freiberuflich verschiedene Projekte.
Will Saunders: Ich arbeite als Klangkünstler. 2012 habe ich mit meinem Mann, dem Fotografen und Videkünstler Hans Diernberger, eine Ausstellung gemacht, deshalb waren wir ein paar Wochen hier und ich mochte den Vibe sehr gerne. Wir sind dann 2014 hierher gezogen und arbeiten seither hier.
iSaAc Espinoza Hidrobo: Ich bin seit elf Jahren in Köln und würde mich am ehesten als Performance-Künstlerx bezeichnen. Ich habe klassische Musik, Geige, an der HfMT studiert und mache jetzt dort zeitgenössischen Tanz. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich hier mit meinem Hintergrund studieren kann, ohne meine Seele an den Teufel zu verkaufen.
Wie fühlt es sich an, in den gegebenen Strukturen in Köln zu studieren und zu arbeiten?
iSaAc: Die Struktur der Hochschule als Institution fand ich zum Studieren sehr hilfreich. Ich habe den Eindruck, dass man in Köln sehr gut leben und arbeiten kann. Ich habe mir hier als Künstlerx einen Namen gemacht und mich exponiert. Meine bezahlte Arbeit hat bisher aber meistens außerhalb der Stadt stattgefunden, was ich sehr problematisch finde. Erst jetzt, nach vielen Jahren, fange ich an, in Köln Dinge zu tun, mit denen ich auch Geld verdiene. Es gibt hier so eine Tendenz, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu helfen, ohne dass man damit Geld verdient.
Will: Es besteht die Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen und dieses Teilen von Ressourcen ist oft gut geplant. Dadurch ist es immer möglich, in Köln ein Projekt auf die Beine zu stellen. Es gibt sehr viel ehrenamtliche Arbeit, so ist es nunmal, aber vielleicht fehlt es da an Transparenz. Wo soll ich etwas unentgeltlich tun, um die Kultur zu unterstützen, und wo sollte ich damit aufhören? Selbst für eine recht kleine Szene begegnet man hier dauernd neuen Menschen. Man arbeitet immer an etwas und bekommt so das Gefühl, Projekte anderer Künstler*innen zu verpassen! Ich muss sagen, dass man schnell das Gefühl hat, auszubrennen, wenn man nicht aufpasst.
Ursula: Es gibt viele junge, motivierte Kreativ-Schaffende hier mit denen ich gerade in Begegnung sein darf, und viele verschiedene Orte, um Projekte zu realisieren. Was mir negativ auffällt, ist, dass in der Musikwelt, die nicht west-europäisch klassisch ist, also u.a. was man Pop, Funk, Schwarze amerikanische Musik oder Jazz nennt, so eine Trennung stattfindet: Es wird nur in den zwei Kategorien „klassisch“ oder „nicht-klassisch“ gedacht. An der Hochschule findet diese Unterteilung in der nicht-klassischen Abteilung auch statt: Da gibt es nur Jazz und Pop. Und beim Jazz gibt es nur diesen einen akademischen und theoretischen Ansatz, es wird zu wenig über die Geschichte, die musikalische Tradition oder die Wurzeln gesprochen. All das fordert mich als Künstlerin in Köln heraus, obwohl ich sehr privilegiert und glücklich darüber bin, dass ich Konzerte spielen kann und ein Publikum habe. Aber ich wünsche mir, dass wir eines Tages über diese Eingrenzungen hinwegkommen.
Habt ihr das Gefühl, dass Köln sichere Orte/Räume für eure Kunst bietet?
Will: Es gibt diese Idee, dass Köln eine queere Stadt ist, aber daran muss noch viel gearbeitet werden. Eine Stadt ist nicht besonders queer, wenn man sie nicht dazu macht, darauf hinarbeitet und Strategien ausprobiert. Aus meiner Sicht ist der Versuch, solche sicheren Räume zu schaffen – nicht nur physisch, sondern auch in Bezug auf die Art und Weise, wie Leute zusammenkommen – in den letzten Jahren stärker geworden. Keiner dieser Orte ist perfekt, aber es wird auf etwas hingearbeitet. Generell finde ich, dass Köln ein wirklich gutes Beispiel dafür sein könnte, wie man Queerness in der freien Musikszene umsetzen kann, wenn sich die Denkweise darüber ändert, wo die Macht sitzt. Seit ich hier bin, habe ich das Gefühl, das es einige starre Strukturen und kulturelle Knackpunkte gibt, die sich nicht lösen. Nur als Beispiel – und korrigieren Sie mich, wenn ich respektlos bin – basierend auf dem, was Ursula gesagt hat, habe ich das Gefühl, dass die Jazzwelt hier eine ziemlich etablierte Form ist und es da nicht viel Reflexion gibt.
Ursula: Du hast völlig recht. Ich habe solche sicheren Räume noch nicht oft erlebt, schon gar nicht in meiner akademischen Ausbildung. Bis Hochschulstrukturen Safe Spaces für mich und viele andere ermöglichen müsste erstmal Machtmissbrauch, Verharmlosung von struktureller Gewalt und der geringe Anteil an nicht-männlichen und PoC Studierenden aufgearbeitet werden. Hinzukommt noch die Abwertung von Kunstformen und musikalischen Traditionen, die nicht dem vorherrschenden Kanon entsprechen und exotisiert werden. Ich glaube auch mitunter ein Grund, warum die Jazzwelt wenig tiefgreifende Reflexion der Werte, Inhalte und Performance Praxen zulässt, ist, dass sie dann selber realisieren würde, wie wenig Wissen und Umgang es mit der Politik und Geschichte von Schwarzer Musik &Kunst gibt, und sich mit dieser Ignoranz und dem Elitarismus auseinandersetzen müsste. Vorallem diejenigen in Machtpositionen sind nicht bereit, daran etwas hinreichend zu ändern. Wenn wir also von sicheren Räumen sprechen, dann geht es auch darum, diese zu schaffen.
iSaAc: Ich stimme definitiv zu, dass wir an einen Punkt kommen, an dem eine reflektiertere und inklusivere Form von Nachdenken über solche Orte in Köln stattfindet. Die Hochschule hatte zum Beispiel diesen offenen Brief, in dem es darum ging, ein LGBTQAI-freundlicher Ort zu sein, erzwungen durch eine Demonstration zu Beginn des Semesters über Queerness und die LGBTQAI-Community. Was die Musikszene angeht, habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass sie allem hinterherhängt. Wenn ich in der Tanzszene oder in einem Performance-Kontext bin, ist der Diskurs über Gender oder Queerness, Dekolonialität, Antikolonialismus usw. so viel weiter gedacht oder überhaupt ein Thema. In der Musikszene habe ich nicht den Eindruck, in einer Community zu sein, obwohl das die Szene ist, in der ich die meiste Zeit verbracht habe.
Will: Es gibt auch keine Transparenz darüber, warum zum Beispiel ein Projekt gefördert oder wonach gesucht wird. In meinen Bewerbungen und Anträgen betone ich Queerness immer, weil es mir wichtig ist. Das kann sich allerdings seltsam anfühlen. Ich habe ein Forschungsstipendium von der Stadt Köln bekommen und dachte: Oh, habe ich das nur bekommen, weil ich gesagt habe, dass ich queer bin? Es kommt mir so vor, als würde ich eine Karte ausspielen.
iSaAc: Tendenziell ist Queerness in der Musikszene gerade ein angesagtes Thema. Ich war auf diesem Neue-MusikFestival in Berlin, wo etwa 70% der Leute aus Köln waren. Es gab da viele Vorträge und Konzerte zu den Themen Queerness und Gender und ich war überrascht, dass fast keine queeren Leute diese Vorträge gehalten haben.
Hast du auch das Gefühl, die queere Karte zu spielen?
iSaAc: Ich möchte eine Aktivistin zitieren, die ich sehr mag. Sie hat gesagt, dass nicht nur wegen meiner Position als Künstlerx, sondern auch wegen meinem Hintergrund, den ich vertrete, jede Karte eine Chance ist. Ich finde nicht, dass ich da einen Vorteil ausnutze.
Ursula: Ich kenne das als nicht-männliche Person in der Jazzwelt auch. Ich habe immer diese Unsicherheit, dass ich nur in ein Projekt aufgenommen werde, weil ich weiblich und eine Instrumentalistin bin. Den Ausdruck „die Karte" mag ich eigentlich nicht. Eine ehemalige Lehrperson von mir hat mal gesagt: Du sollst nicht auf die Frauen-Karte setzen, das wird mir sonst sehr auf den Kopf fallen. Und das finde ich in diesem Zusammenhang sehr problematisch. Als würde ich jeden morgen aufstehen und zur teuflischen Frauenquote beten, dass ich Arbeit und Prestige bekomme, „ohne was dafür zu tuen“ – was ein Quatsch. Diese Projektion von Faulheit und Inkompetenz und auf nicht-männliche Personen in der Musikwelt konstruiert eine Haltung, die ich so noch nie erlebt habe und ignoriert außerdem völlig die strukturelle Benachteilgung von nicht-männlichen Personen. Und wenn es Anfragen gibt, die besonders an FLINTA* Künstler*innen suchen ist eigentlich nicht einmal eine „Karte“, es ist einfach eine Gelegenheit. Und wir können Gelegenheiten nutzen, wenn sie sich bieten. Ich habe das Recht, da zu sein, und will das nicht andauernd in Frage stellen.
Was denkt ihr über die Trennung oder Verbindung von Kunst und Identität?
Will: Identität und Kreativität sind miteinander verwoben. Das ist einer der Gründe, warum man überhaupt kreativ arbeitet und zu vielen anderen Dingen fast passiv „Nein“ sagt. Die Frage dabei ist: Wer darf überhaupt definieren, wie Identität und Kreativität miteinander verwoben sind, insbesondere in Bezug auf Queerness. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man damit anfängt, Queerness zu benennen. Aber in den meisten Fällen werden wichtige Personen (die es immer schon gibt!) nicht zur Diskussion eingeladen. Das liegt wahrscheinlich an den etablierten Strukturen: Es heißt zum Beispiel: Oh, wir brauchen ein neues Finanzierungskonzept und Queerness muss darin vorkommen. Aber wenn Queerness dann benannt wird findet das ziemlich oberflächlich statt. Ab und zu denke ich: Ich bin zwar queer, aber ist das wichtig für meine Kreativität oder wie sie kategorisiert wird? Meine Musik ist an und für sich nicht queer, es ist die Art der Zusammenstellung von Instrumenten, die ich vielleicht nutze, oder kleine Entscheidungen, die ich treffe, oder sogar, woher ich die Rechtfertigung habe, überhaupt auf der Bühne zu stehen und die Leute zum Zuhören zu bringen. Ich schätze, es fühlt sich für jede queere Person seltsam an, etwas zu repräsentieren, das für jede*n sein sollte. Das ist keine Kategorie, es ist eine Bewegung. Die Frage könnte auch lauten, wer so gesehen denn keine Identität hat.
iSaAc: Aus der Musikperspektive betrachtet, könnte man vielen Komponistenx, die ich kenne, Gender-Fragen stellen. Sie machen einfach ihre Kunst, sind durch ihre Position aber privilegiert. Ich denke, es ist verletzend, wenn man eigene Identitäten trennen soll. Ich habe das Gefühl, dass ich ein besserer Musikerx bin, weil ich eben auch mit meinem Körper arbeite, weil ich Identitäten miteinander verbinde und Grenzen austeste. Ich hinterfrage die Rolle des Performerx bzw. Musikerx bzw. Tänzerx bzw. wessen auch immer. Mich interessiert die Überschneidung dieser Formen und die Möglichkeit, auf der Bühne damit zu spielen. Eigentlich ist der Prozess, Identitäten zu verflechten, sehr wertvoll und es geht darum, mit wem ich ihn teile. Ich will ihn mit so vielen Menschen wie möglich teilen, ob das nun mit Queerness zu tun hat oder mit etwas anderem.
Ursula: Ich spüre diese Verflechtung bei jedem kreativen Prozess. Es ist gleichzeitig interessant und schmerzhaft zu beobachten, wie an Musik-Institutionen dieses Thema den anderen Bereichen der Kunst hinterherhinkt, und Gestaltung von individueller Identität & Kunst, wie auch kollektiver Identiäten, und einem gemeinsamen Neuen nicht ausreichend Thema ist. Vielmehr wird es erwartet sich mit dem Kanon, dem Mainstream, der engen Norm, mit klarer Hierarchie zu identifizieren, ohne ausreichend zu erklären wieso. Geschweige denn, in welchen verschiedenen Formen unsere Identiäten eine Rolle im Bezug auf Kunst spielen. Es ist für mich ein andauernder Prozess mich von Ästhetischen Normen zu befreien und mehr den Fokus auf diese Verflechtung zu setzen, und wünsche mir, dass das mehr zelebriert und gefördert wird.