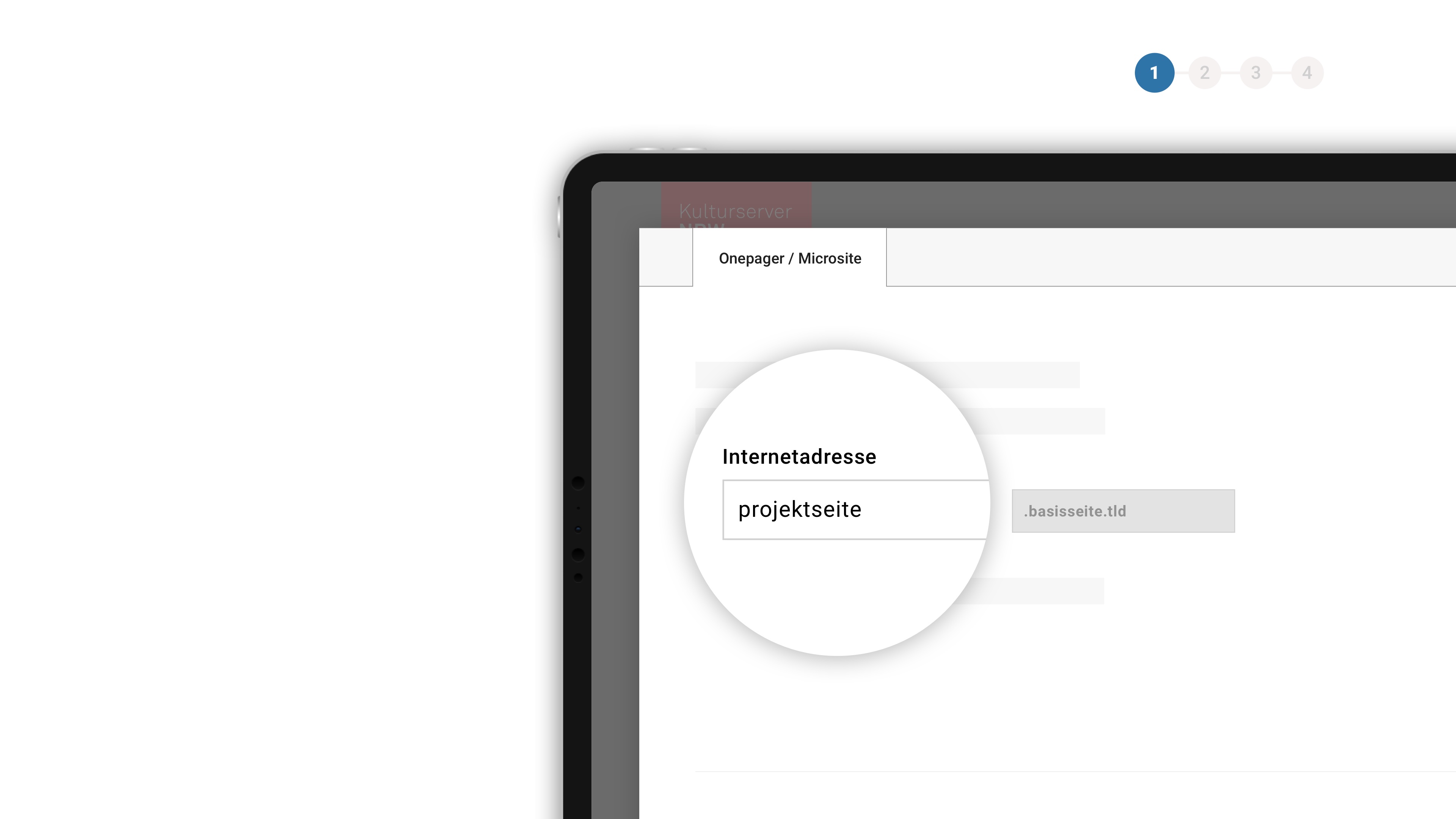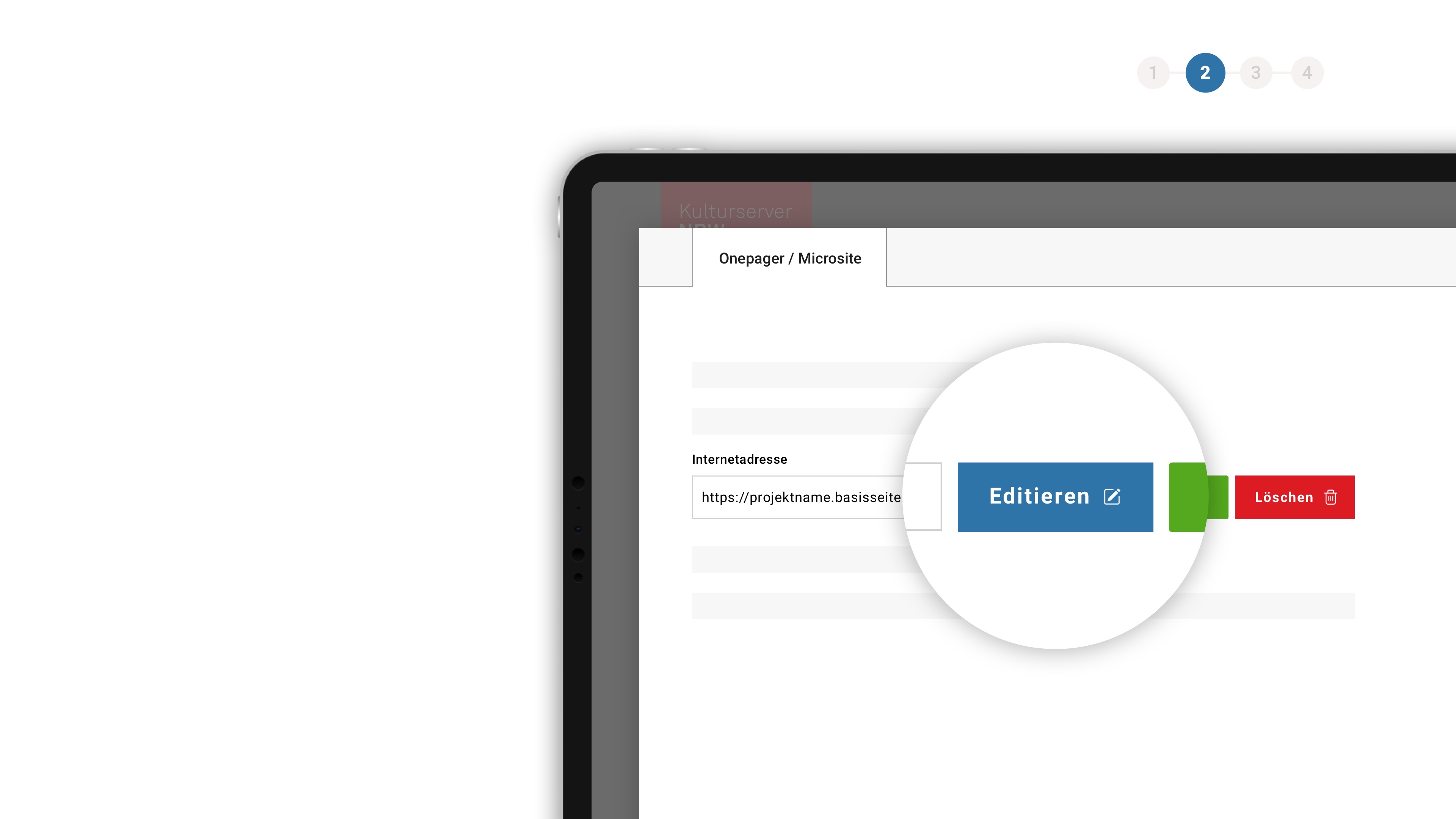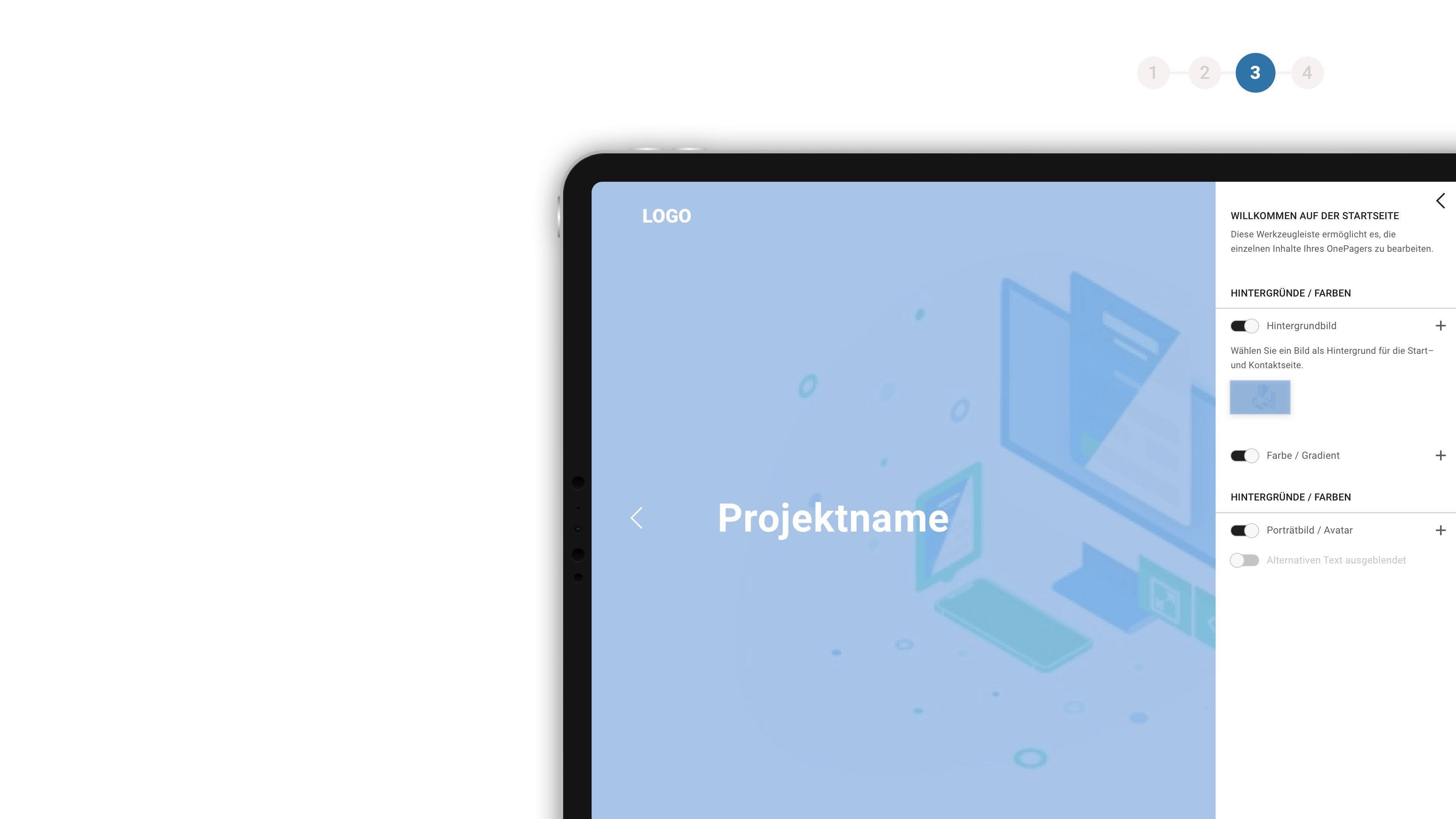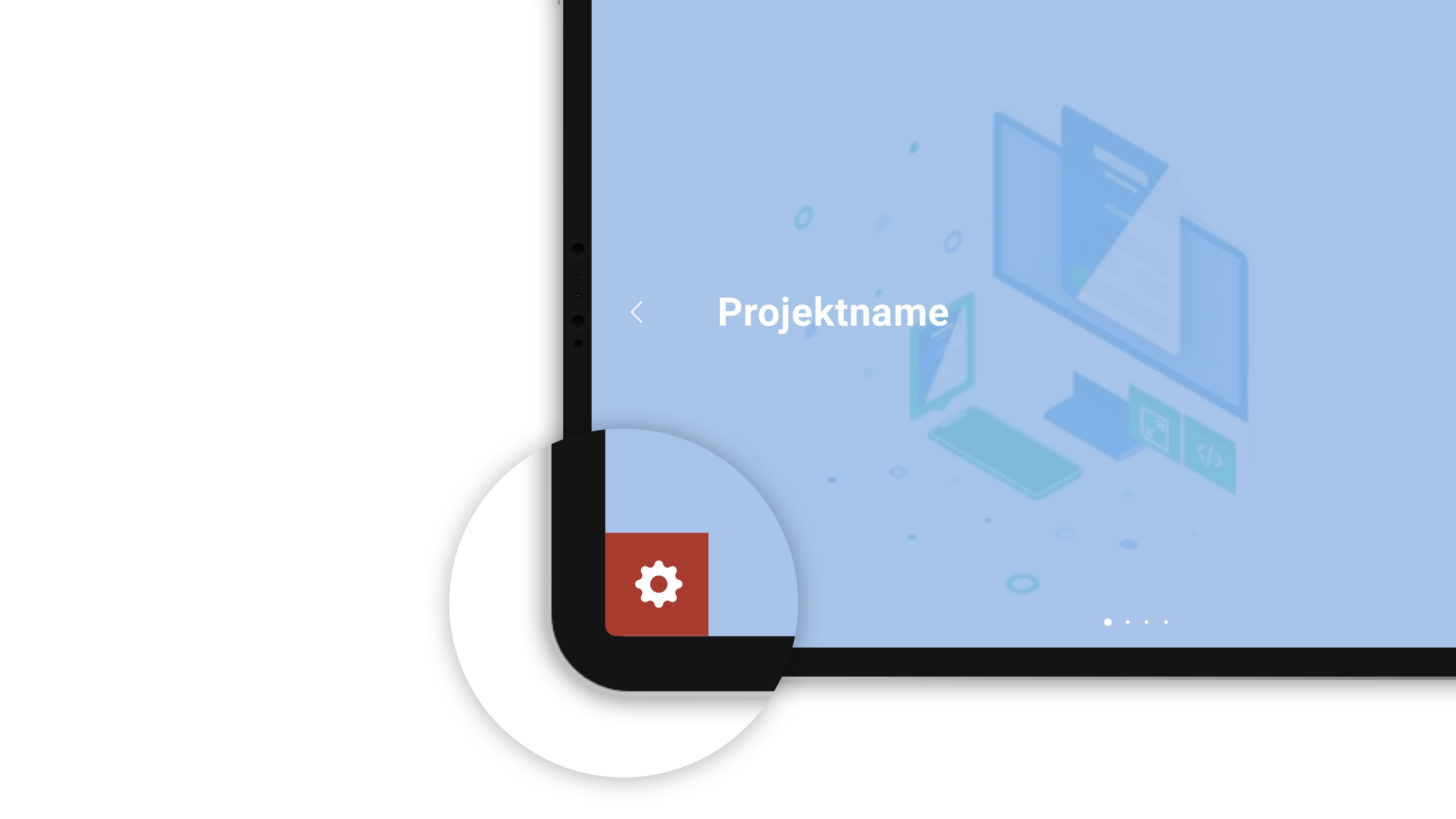Rafael Montero

„Macht Platz für indigene Musik“
Rafael Montero ist Tenor – allerdings nicht im klassischen Sinne. Er kämpft für Sensibilisierung und Akzeptanz von Marginalisierten, die Musik seiner Vorfahren und Geschichtsrevision.
Von Sophie Emilie Beha
Quechua, Aymara und Guaraní – neben Englisch und Deutsch spricht Rafael Montero drei indigene Sprachen aus Lateinamerika. Geboren in der nordargentinischen Region Jujuy, stammt Rafael Montero aus einer indigenen andinen Familie vom Volk der Kolla. Die Kolla sind traditionell vor allem Reisende und Heilende, der kleine Rafael zog seit er laufen konnte mit seiner Mutter los, um Kräuter zu sammeln und andere zu heilen. Die Musik begleitet ihn ebenso lange: Sein Vater spielt zuhause oft auf Charango, ein Art indigener Adaption einer Barockgitarre. Dazu wird oft gesungen. Montero ist bald klar: Er will Musik machen. Allerdings denkt er dabei nicht an die traditionellen Lieder und Kompositionen, die er mit jeder Faser seines Körpers auswendig weiß, sondern an die weiße Musik des Westens. „Dadurch, dass ich aus einem kolonisierten Land komme, bin ich aufgewachsen mit dem Gedanken, dass die europäische Kultur besser ist als unsere.“ Wie viele Menschen of Color hatte Montero eine weiße Sichtweise der Welt internalisiert. Das nennt man den white gaze. Er funktioniert wie eine Linse, durch die man auf die Dinge blickt. Wie auch nicht? Noch immer ist das weiße Narrativ der Kolonialherren omnipräsent, in Chile wie hierzulande wird Kulturen nicht die gleiche Daseinsberechtigung zugeschrieben. „Wir hätten längst aus der Kolonialzeit lernen müssen: Keine Kultur ist besser als die andere.“ Kein Wunder also, dass Montero zunächst klassischen Gesang sowie Alte Musik und Kammermusik in Córdoba, Argentinien und Neuchâtel, Schweiz, studiert, nächtelang über Mozart und Haydn brütet und seine Stimme so trainiert, wie er es an der Universität lernt. Er wendet sich der Alten Musik zu, der Klassik und der zeitgenössischen Musik, spezialisiert sich auf spanische und südamerikanische Barockmusik der Renaissance und auf romantische und aktuelle Musik aus Lateinamerika. Aber irgendetwas fehlt. Egal wie viel er übt, so richtig zuhause fühlt sich Montero in den Arien und Kantaten nicht – und auch nicht als indigene, homosexuelle, non-binary Person in Europa.
Rafael Montero sucht – nach seinen Wurzeln und nach sich selbst. Er findet alte Keramik-Gefäße aus Zeiten der Inkas, auf denen Männer abgebildet sind, die Sex miteinander haben, polygame Beziehungen und sogar Drag Queens: Männer (sogar Priester), die weiblich gelesene Kleidung trugen. Auch „feminine Männer“, wie Rafael Montero sich selbst bezeichnet: Zu Zeiten der Inka lebten sie in Tempeln und waren hoch angesehen vom Volk, da sie „beide Seiten“ in sich vereinten. Durch seine Entdeckungen fühlt sich Montero tief bestätigt, er interessiert sich immer mehr für die indigene Musik der Anden, aus denen auch sein Volk stammt. Ihn faszinieren die alten Melodien, indigene Komponist*innen und queere Musiker*innen, die lange vor dem ersten Kolonisator durch die Täler und Berge wanderten. Inspiriert davon gründet Rafael Montero in Köln und London das Ensemble El Parnaso Hispano. Es kontrastiert spanische Werke aus Renaissance und Barock mit alten Liedern und Tanzmelodien der Quechua, Aymara und Guaraní, die Jahrhunderte überdauert haben. Montero gräbt vergessene Werke indigener Komponist*innen aus und führt sie auf oder interpretiert traditionelle indigene Lieder als Kunstlied an der Seite des bolivianischen Pianisten Daniel Alvarez Veizaga. Immer vor einem vorwiegend weißen Publikum. Um die alten Lieder seiner Vorfahren in Europa singen und aufführen zu dürfen, hat sich Montero die Erlaubnis einer Schamanin in Argentinien eingeholt: „Sie sagte mir: Die Emotion ist wichtiger als alles andere! Wenn wir diese Musik machen, muss man die Emotionen hören können und nicht nur schöne Klänge.“ Als Nachfahre einer schamanischen Familie will Montero mit seinem Gesang auch heilen – dafür seien Emotionen unabdingbar. Momentan stellt Montero ein Notenbuch mit indigenen Kinderliedern zusammen, die dazugehörigen Aufnahmen erscheinen im November.
„Es ist wichtig, dass Leute indigene Musik hören, die von Indigenen gespielt wird“, sagt Montero mit Nachdruck. „Indigene Alte Musik oder Neue Musik aus Lateinamerika gehört den indigenen Stimmen, bitteschön, nicht irgendwelchen weißen, die vielleicht auch schön singen können. Dafür muss Platz sein.“ Montero wünscht sich dafür mehr Aufmerksamkeit von Festivals, Veranstalter*innen und Komponist*innen. „Mein Körper ist anders, meine Hormone sind anders. Meine Stimme klingt nicht typisch und das will sie auch gar nicht. Ich will, dass diese Stimme genauso respektiert wird und auch Werke für meine Lage geschrieben werden.“ Für einen klassischen Tenor wäre Monteros Stimmlage relativ hoch, in den indigenen Andenkulturen ist das allerdings typisch, Menschen mit Basslage gäbe es dort so gut wie nicht, sagt Montero.
Mittlerweile ist seine indigene Kultur für Rafael Montero die Essenz. Sie prägt, wie er die Welt betrachtet und über sie denkt, seine fließenden, ausladenden Bewegungen, mit denen Montero mit femininen Zuschreibungen kokettiert und das große Lächeln, das er seinem Gegenüber bereitwillig schenkt. In Workshops gibt er sein Wissen über seine indigene Stimme weiter und will „das Feminine“ in Männern aufwecken. Wenn man Montero so zuhört, hat man oft das Gefühl, dass er Sachen richtigstellen will. Den Lehrplan in Schulen und Universitäten, die Schubladen, in die er sein Leben lang gesteckt wird und die wie festgeleimt wirken, die Geschichtsschreibung, in der indigene Perspektiven kaum vorkommen und wenn, dann nur in fremdbestimmten Rollen.
Gerade hat sich Montero viele Aufnahmen seiner Vorfahren angehört. Aufgenommen hat sie der Ethnomusikologe Robert Lehmann-Nitsche im Jahr 1905 – natürlich ohne vorher zu fragen. Die Aufnahmen schlummerten Jahrhunderte in den Archiven des Phonographischen Museums und des Humboldt Forums in Berlin, bevor Montero von ihnen erfuhr. Als er die vertrauten Gesänge hörte, die er zum Teil schon von seiner Großmutter gehört hatte, „die eingesperrt waren, da habe ich tagelang geweint.“ Gemeinsam mit dem chilenischen Komponisten Ramón Gorigoitía aus Köln entsteht nun eine Oper über die Feldaufnahmen und ihre rassistische Geschichte. Die Uraufführung ist kommendes Jahr geplant.
Rafael Montero ist im Januar 2024 im Rautenstrauch-Joest-Museum zu hören.
Mit freundlicher Unterstützung durch: KULTUR.GEMEINSCHAFTEN - Kulturstiftung der Länder / Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien / NEUSTART KULTUR
In Kooperation mit diskursmusik.com