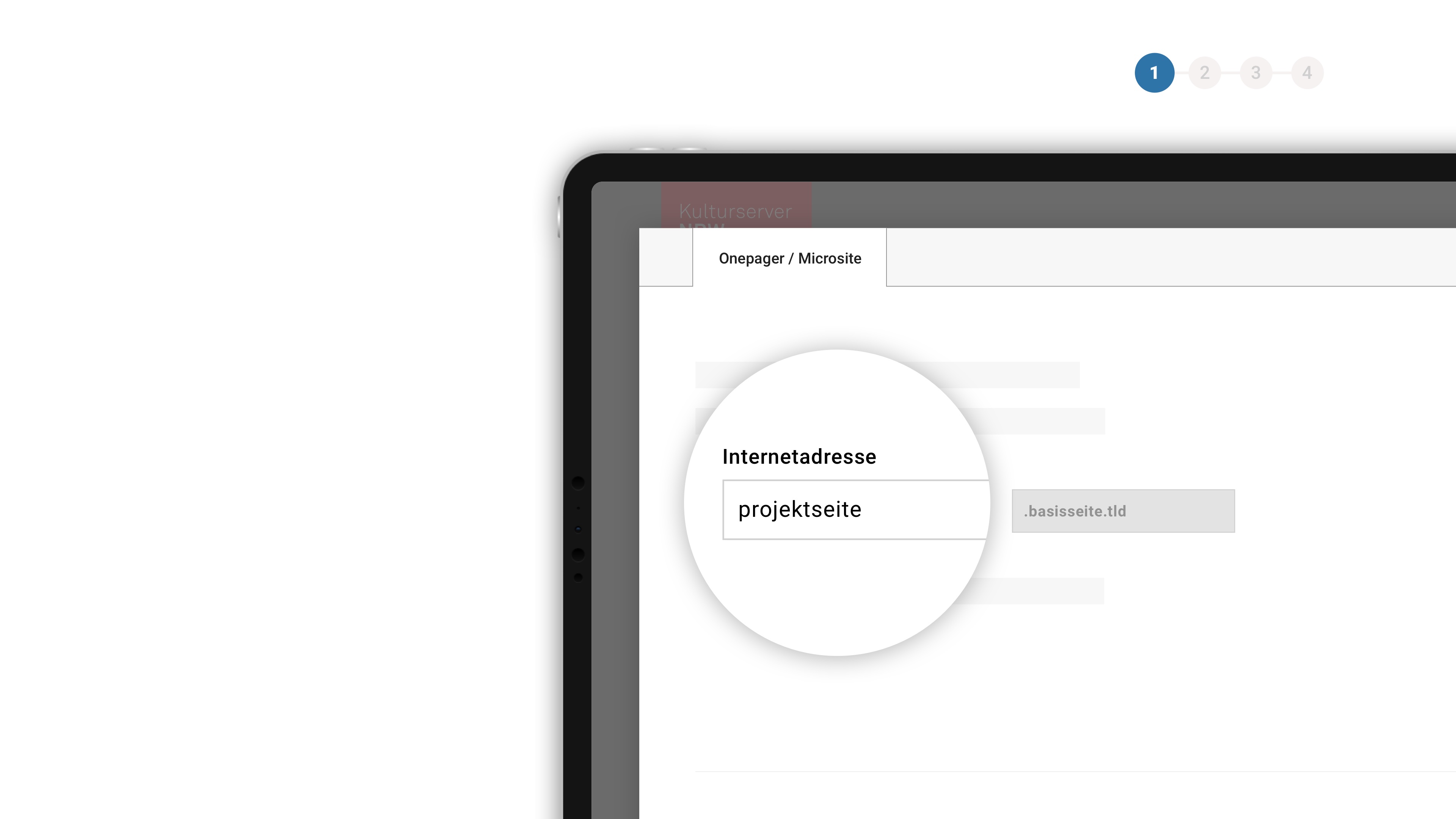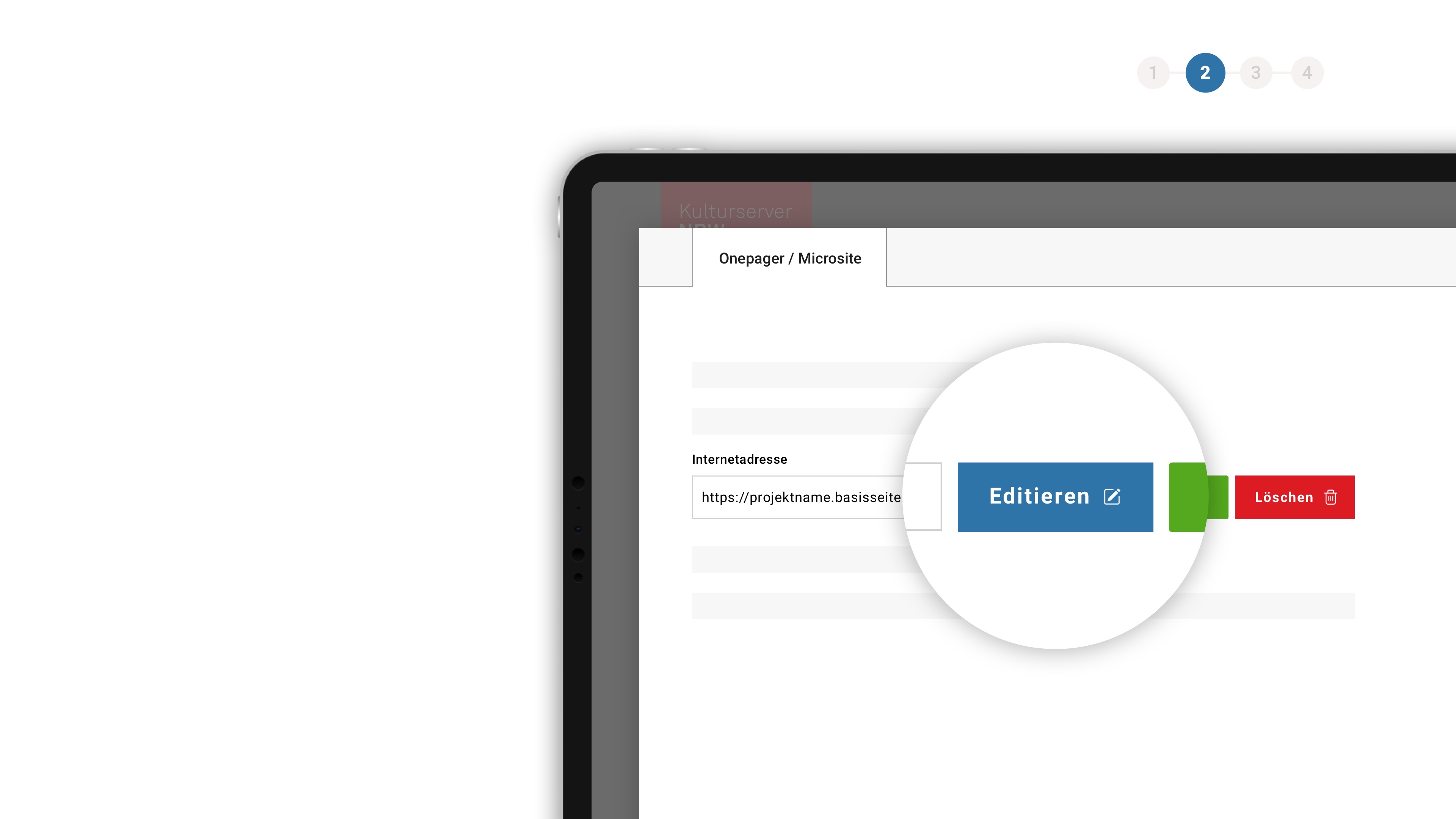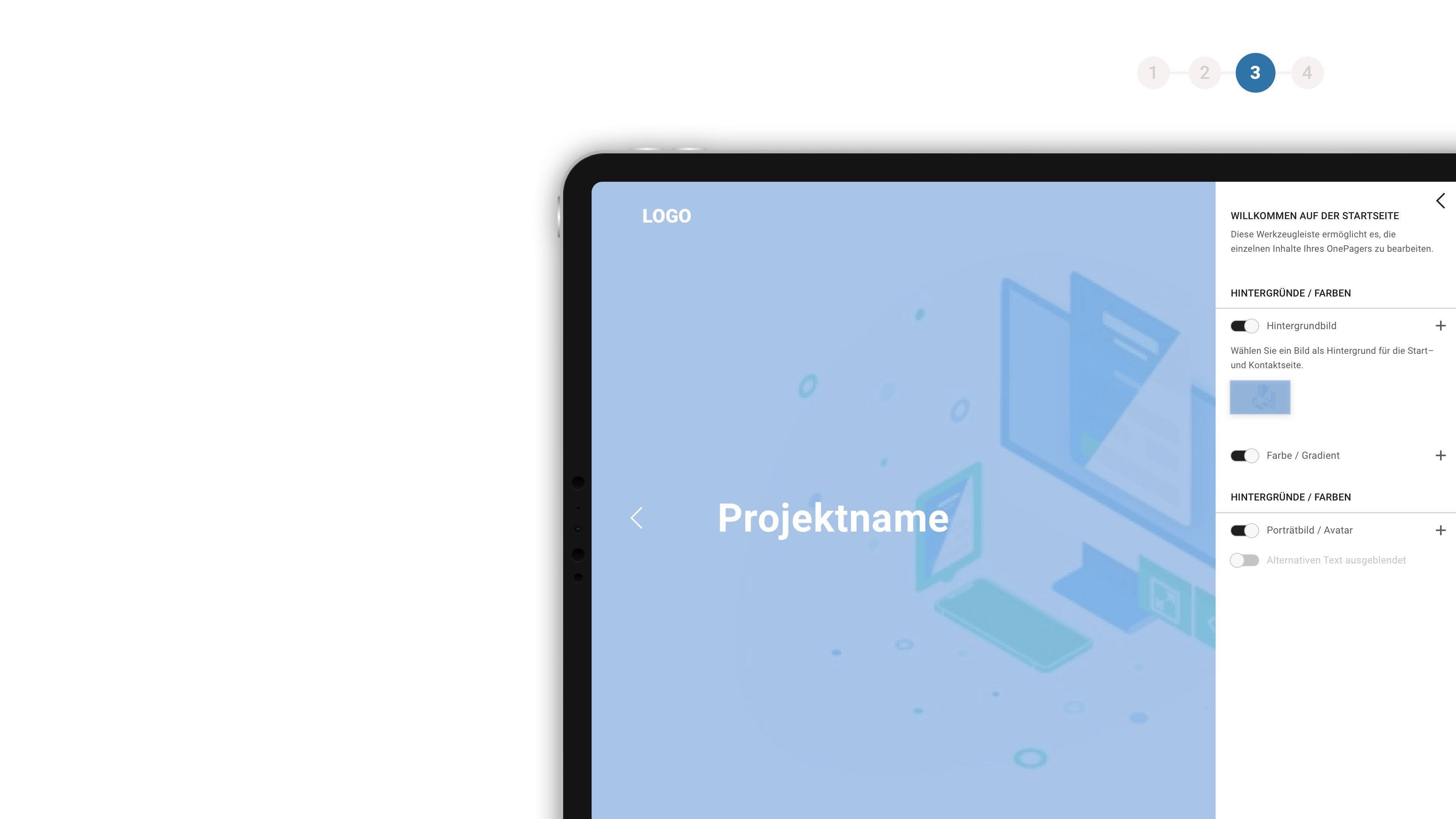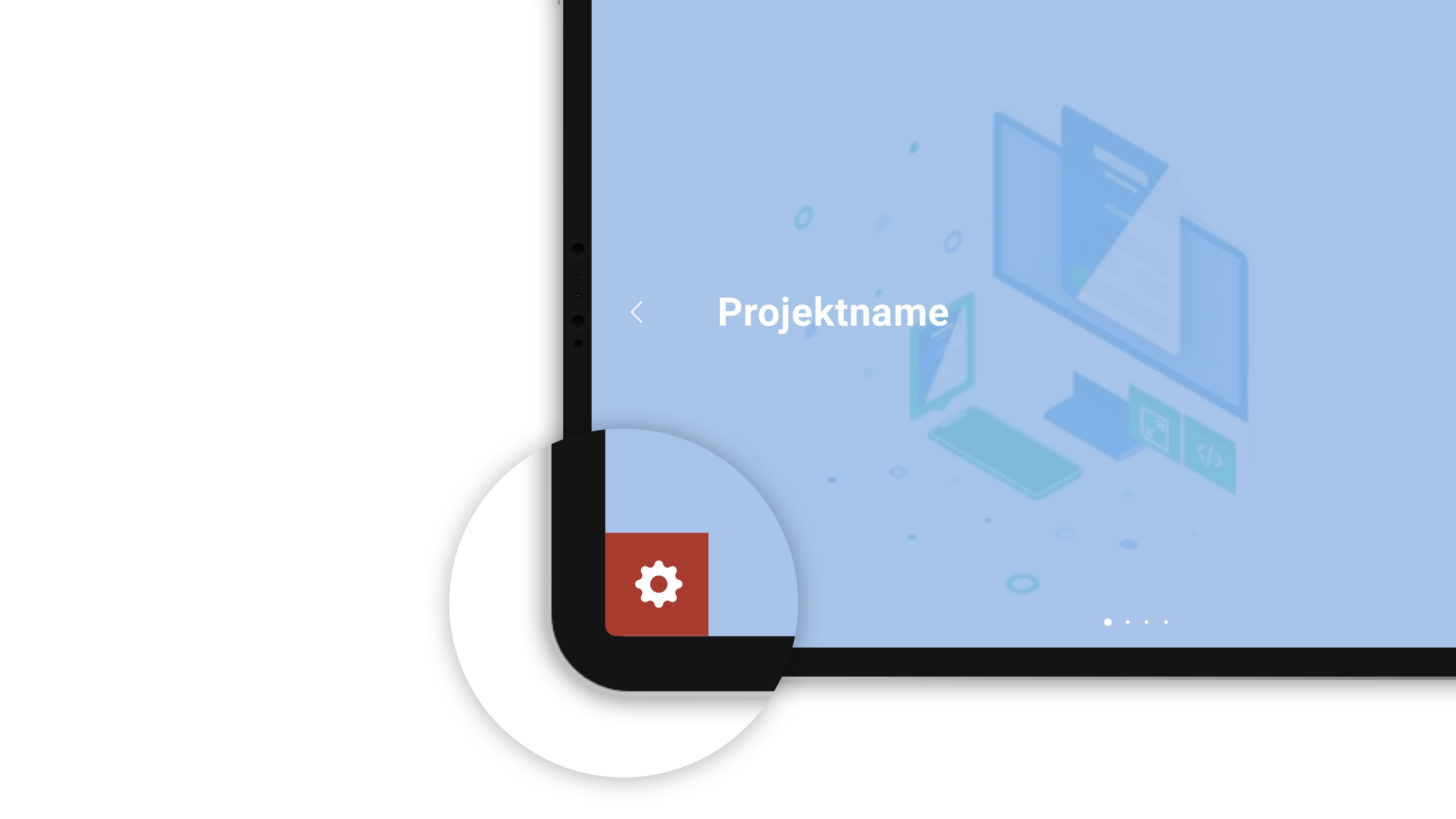Kölner Klangimpulse – Alte Musik im Rheinland
Auf dem Programm standen sowohl ein Fachvortrag von Johannes Löscher zur Geschichte des Kölner Geigenbaus als auch eine Lecture Performance des Kölner Musikers und KGAM/zamus Vorstandsmitglieds Norbert Rodenkirchen zum Thema Die Melodie der Mauern, persönliche und berufliche Erfahrungen. Beendet wurde der Abend von einem Kammermusikkonzert des Ensembles „In-Between“ mit KGAM/zamus Vorstandsmitglied Ha-Na Lee, Huda Knobloch und Marie Luise Wundling. Die Musikerinnen interpretierten Streichtrios aus Klassik und Romantik von Johann Georg Albrechtsberger und Franz Schubert in Historisch Informierter Aufführungspraxis.
Die zusammengefassten Vorträge:
Johannes Löscher: Streichinstrumente für die „Alte Musik“ in Köln
Vom Kölner Streichinstrumentenbau im 17. und 18. Jahrhundert, also der Zeit, die die „Alte-Musik-Bewegung“ in ihren Anfängen besonders interessierte, ist sehr wenig überliefert. In seiner Enzyklopädie „Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart“ erwähnt Willibald Freiherr von Lütgendorff gerade einmal fünf Namen, bekannte Instrumente sind extrem rar.
Nach dem 2. Weltkrieg bot sich ein ähnliches Bild: in Köln gab es nur sehr wenige Geigenbauer und gar keine, die Streichinstrumente in historischer Einrichtung herstellen oder beschaffen konnten. So mussten in der 1954 begonnenen Gründungsphase der „Cappella Coloniensis“, dem Alte-Musik-Orchester des Westdeutschen Rundfunks, sogenannte „Originalinstrumente“ durch den Geigenhändler und -sammler Josef-Stefan Blum, der auch Mitglied der Cappella war, von außerhalb angekauft werden. Dennoch spielten zahlreiche Mitglieder noch lange mit modern eingerichteten Instrumenten, die mit Darmsaiten bezogen waren. Nur der „Barockbogen“ war anscheinend verpflichtend.
Besonderen Wert auf authentisch eingerichtete Geigen legte dann aber seit den 1970er Jahren das Ensemble „Musica Antiqua Köln“ unter Reinhard Goebel, der diese in allen Details in den Einführungstexten zu seinen Schallplattenaufnahmen beschreibt.
Aber auch zu dieser Zeit gab es in Köln noch keinen historisch informierten Geigenbauer, die Musiker mussten sich beispielsweise nach Den Haag an Bouman oder Springe und Berlin an Familie Muthesius wenden. Die Impulse kamen interessanterweise eher aus dem Cembalo- und Gambenbau: Günther Hellwig in Lübeck, 1928-32 bei Arnold Dolmetsch in Haslemere tätig, war hier eine ganz zentrale Figur. Seine Schüler und Gesellen, wie Muthesius, Ossenbrunner, Brosse und Uilderks und wiederum deren Lehrlinge und Mitarbeiter spielten und spielen für die Kölner Alte-Musik-Szene eine zentrale Rolle. Aber auch neue Streichinstrumente der ehemaligen Cembalobauer Rubio und Hargrave wurden zunehmend nachgefragt. Eine wichtige Informationsquelle für die Kölner Musiker waren die Instrumentenausstellungen anlässlich der von der Alte-Musik-Redaktion des WDR initiierten Tage Alter Musik in Herne, bei denen die obengenannten Geigen- und Gambenbauer fast alle präsent waren.
Durch Fachpublikationen und Museumskataloge hat sich seit den 1980er Jahren das Wissen über den historischen Geigenbau deutlich verbessert und erweitert, sodass dem Musiker:innen auch sehr differenziert im Hinblick auf die jeweilige Musikepoche eingerichtete Instrumente zur Verfügung gestellt werden können. Inzwischen sind in Köln mindestens sechs spezialisierte Geigen- und Bogenbauer:innen tätig.
Norbert Rodenkirchen: Die Melodie der Mauern, persönliche und berufliche Erfahrungen
Der allererste historische Kölner Instrumentalklang, der in unserer Zeit wieder zum Klingen gebracht werden kann, stammt von der sogenannten Severinsleier, einer aus dem 8. Jahrhundert stammenden kleinen Sängerharfe, gefunden in einem Merowingergrab an St. Severin in der Südstadt. Mit einem improvisierten Präludium auf diesem sechssaitigen Instrument begann die Lecture Performance, welche sich zunächst thematisch auf das Mittelalter konzentrierte. Das Mittelalter darf ja getrost als epochenunabhängiges Sinnbild der inneren Antriebskraft Kölns zwischen Innovation und Konservativismus gelten.
Mönche und Nonnen sangen Gregorianik aus Neumenhandschriften, also einer Notation ohne klare rhythmische Angaben oder Bestimmung der Tondauern. Es war aber ein Kölner, nämlich Franco von Köln, der in einem revolutionären Akt im 13. Jahrhundert mit dem Beginn der Ars Nova die eindeutige rhythmische Bestimmung der Notenwerte festlegte. Diese Praxis – eine echte Innovation von großer Tragweite – ist mit der Einteilung der Noten in Viertel, Achtel, Sechzehntel etc. bis heute gültig und wird in der Musikwissenschaft als „Frankonische Notation“ bezeichnet. Als Beispiel der rhythmischen Komplexität, welche durch diese Neuerungen erstmals aufschreibbar und somit für die Komponist:innen nutzbar wurde, gab es am 6.12. ein Audiobeispiel einer Aufnahme des Kölner Ensembles „Sequentia“ aus dem Jahre 1990 mit Musik von Philippe de Vitry (1291–1361). Ein weiterer außergewöhnlicher Aspekt der Musik des rheinischen Mittelalters waren die ekstatischen Gesangsstile in der lokalen Gregorianik. Im Museum Schnütgen liegt das interessante Manuskript mit dem Antiphonar der Anna Hachenberch, im späten Mittelalter im Frauenkloster an St. Cäcilien entstanden. Bemerkenswert ist die Handschrift, weil sie eine melismatisch virtuose Musik enthält, die sich mit ihren vokalen Ornamenten und Verzierungen nahtlos in die mystischen Traditionen des rheinischen Mittelalters einfügt, wovon die Musik Hildegard von Bingens heute das bekannteste Bespiel ist. Die Besucher:innen am 6. Dezember durften hier einer WDR-Aufnahme des Ensembles „Candens Lilium“ lauschen. Zu hören war ein Responsorium der Anna Hachenberch über das außergewöhnliche Doppel-Patronat von St. Peter, der heutigen Kunststation, und St. Cäcilien, dem heutigen Museum Schnütgen, mit ihren gemeinsamen Heiligen Evergislus und Caecilia.
Zur Nachkriegszeit
Im weiteren Verlauf schwenkte der Vortrag um zur Szene für Alte Musik von 1950 bis 1990, von der „Capella Coloniensis“ bis zu den frei gegründeten Ensembles der 1980er Jahre. Die außerordentliche Bedeutung der „Capella Coloniensis“, des international ersten Orchesters für Historische Aufführungspraxis mit rekonstruiertem Originalinstrumentarium – vom NWDR ins Leben gerufen – kann gar nicht überschätzt werden. Die ungewohnte Klanglichkeit der erstmals umfangreich rekonstruierten Instrumente und Spielweisen war aufsehenerregend, blieb aber in ihrer Qualität nicht unumstritten und weckte beim Radiopublikum und im Konzert sowohl Zustimmung als auch Ablehnung.
Von der ersten zur zweiten Generation
Die Mitglieder – allesamt Pioniere – waren oft auch Lehrende an der Kölner Musikhochschule und prägten somit die nachfolgenden Generationen, vor allem Günther Höller für Block- und Traversflöte und der Geiger Franz Josef Meyer. Aus dessen Klasse entstammte Reinhard Goebel, der in den 1970er Jahren „Musica Antiqua Köln“ gründete, eines der revolutionär eingestellten Ensembles der zweiten Early Music Generation, die weltweites Aufsehen erregte. Zu dieser zweiten Generation gehörten ebenfalls der Zinkenist Roland Wilson, der sich mit seinem Ensemble „Musica Fiata“ dem Frühbarock widmete und „Sequentia“, Ensemble für Musik des Mittelalters, von Barbara Thornton und Benjamin Bagby 1977 in der Kölner Moltkestraße gestartet.
Alleine die Gründer dieser zuletzt genannten drei Kölner Ensembles sind bis auf die 1998 verstorbene Barbara Thornton noch heute mit interessanten Projekten künstlerisch produktiv. Zum großen Teil sind sie auch Mitglieder im zamus, wo sie sich wiederum mit den nachfolgenden Generationen in fruchtbarem kreativem Austausch befinden. Besonders hervorzuheben ist 1985 die Gründung von „Concerto Coeln“, dem ersten freiberuflich und basisdemokratisch organisierten Profi-Orchester im Bereich der Alten Musik in unserer Stadt.
Es ging in der zweiten Generation nach der „Capella Coloniensis“-Gründerzeit zum Beispiel um die Frage, ob geistliche Musik wie bis dahin üblich mit großen Chören und Orchestern oder aber in kleinster Besetzung in Einzelstimmen aufgeführt werden sollte. Diese Frage war ein wichtiger kreativer Streitpunkt dieser Zeit und ist bis heute nicht eindeutig entschieden. Während des Abends verdeutlichte eine gemeinsame Aufnahme von „Cantus Cölln“ und „Musica Antiqua Köln“ das Prinzip der reduzierten Originalbesetzung exemplarisch. Wie im Ausstellungskatalog beschrieben kamen ferner in den 1970ern und 1980ern deutlich neuartige Impulse in die Bewegung für Alte Musik, welche auch die aufführungspraktischen Traktate (also u.a. Leopold Mozart für die Violine, Quantz für die Traversflöte, C.Ph. Bach fürs Klavier) intensiver ins Spiel einbrachten und wesentlich konsequenter anwendeten, auch im Bewusstsein alternativer Lebens- und Ausdrucksweisen in der Gesellschaft. Es ging um eine Abgrenzung gegenüber der Hochglanzklassik. Heute ist es ja absoluter Standard, Barockopern, Oratorien und frühe sinfonische Werke auf original rekonstruierten Instrumenten und historisch Informiert aufzuführen. Das war damals nicht der Fall, Early Music galt als eine Nische.
Ausblick ins Neue
Jede Generation muss neu definieren, was für sie die Historisch Informierte Aufführungspraxis ist und wie stark sie sich darauf beschränken oder Öffnungen zu anderen Ausdrucksformen zulassen will. Die von den Pionieren angestrebte Objektivität des authentischen Werkzugangs („so hat es bei Bach geklungen“) hat sich im Laufe der Jahrzehnte als Trugschluss entpuppt. Der heutige Zugang im Konzertbetrieb, in der Oper und bei Aufnahmen für Tonträger und Rundfunk setzt in den meisten Fällen die künstlerische Anwendung der Errungenschaften der Historisch Informierten Aufführungspraxis als selbstverständlichen Standard voraus, verlangt aber neben bestmöglicher historischer Recherche ebenso nach zeitgemäßen Präsentationsformen und der Begegnung mit anderen Ausdrucksweisen, um auch in unserer Zeit ein tiefes Kunsterleben Alter Musik zu ermöglichen.
In diesem Zusammenhang lohnt ein Blick in die Kölner Gegenwart. Wiederum in alten Kölner Mauern, dem Heliosturmgebäude in Ehrenfeld, entsteht zur Zeit das erweiterte zamus, also das vergrößerte Zentrum für Alte Musik mit Konzertsaal, Proberäumen, Büros und Tonstudio. Ein Raum auch für Experimente und für neue Klangvisionen im Bereich der Alten Musik und weit darüber hinaus.